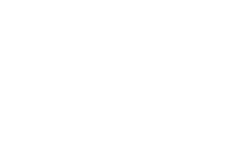Gastbeitrag von Palle Petersen
Plädoyer für ein herrliches Durcheinander
Gastbeitrag von Palle Petersen
Die Klimakrise verlangt eine neue Umbau- und Reparaturkultur. Für Architekten ist das kein Verlust, sondern eine Bereicherung. Für alle anderen auch.
Abriss oder Umbau? Seit einigen Jahren bewegt diese Frage die Architektinnen, Bauherrschaften, Ingenieure und Bauämter wie keine zweite.
2022 forderte der Bund Deutscher Architektinnen und Architekten ein landesweites Abrissmoratorium, um auf die ökologische und wohnpolitische Problematik hinzuweisen. Zeitgleich lancierten die Schweizer Klimaaktivistinnen von Countdown 2030 einen Abriss-Atlas und kuratierten die Ausstellung »Die Schweiz: Ein Abriss«. Dazu kommen Kongresse, Podien und Debatten um Einzelprojekte – etwa um das Münchner BR-Studio oder das Berliner Urania-Hochhaus. Und um viele, viele Wohnsiedlungen.
Die »Ersatzneubauwalze« ist vor allem innerstädtisch zum Feindbild geworden. In der Regel mischt sich dabei sozialpolitische Kritik rund um Verdrängung, den Verlust von Identität und günstigem Wohnraum mit ökologischer Kritik rund um Abfallberge und »graue Emissionen« – jene Treibhausgase, die nicht beim Gebäudebetrieb anfallen, sondern beim Bauen selbst, vom Rohstoffabbau über die Verarbeitung bis zur Baustelle.
Diese Kritik ist berechtigt. Nebst Suffizienzfragen – wie Komfortansprüche oder Flächenverbrauch pro Kopf – ist eine Umbau- und Reparaturkultur der größte Hebel für eine klimataugliche und kreislauffähige Baukultur. So sinnvoll es ist, Staubsauger ins Repaircafé zu tragen und Hosen zum Quartierschneider: Im Bausektor spielt die Ressourcen-Musik, und was schon da ist, muss nicht gebaut werden.
Umbauen als Gebot der Stunde, als sozioökologischer Imperativ: Was heißt das für Architektinnen? Sind ihre Kreativität und Freiheit bedroht? Geht der Baukunst der Schöpfungsakt verloren?
Mais au contraire!
Der Gebäudesektor ist in Europa je nach Land für etwa 30-40 Prozent aller CO2-Emissionen verantwortlich. Etwa zwei Drittel davon entfallen auf den Betrieb, ein Drittel auf die Erstellung im Hoch- und Tiefbau.
Die Betriebsemissionen entstehen vor allem beim Heizen mit fossilen Energieträgern. Der größte Hebel für den Klimaschutz im Bausektor liegt also noch immer darin, Öl- und Gaskessel durch Wärmepumpen zu ersetzen und die Gebäude besser zu dämmen. Diese Rezepte sind bekannt, gefördert und gefordert. Der Neubau ist hinreichend reguliert.
Die Erstellungsemissionen, auch graue Emissionen genannt, entstehen beim Bauen selbst – vom Rohstoffabbau und der Verarbeitung zu Bauprodukten über die Transporte zu Fabriken und Baustellen bis zur Energie für die Baumaschinen. Bei durchschnittlichen Neubauten machen sie etwa die Hälfte der Emissionen im gesamten Lebenszyklus aus. Bei ambitionierten Neubauten sind es zwei Drittel und mehr. Der lebhafte Fachdiskurs rund um graue Emissionen ist darum richtig: Gesetzlich gibt es noch keine griffigen Anforderungen. Von einer vollständig dekarbonisierten Bauindustrie sind wir noch weit entfernt. Auf lange Sicht liegt hier die Knacknuss.
Vor diesem Hintergrund ist der Baubestand doppelt wichtig: Einerseits ist die energetische Sanierung der Nachkriegsbauten wichtiger als noch höhere Anforderungen im Neubaubereich. Zweitens stecken allein in der Tragstruktur und den Fassaden knapp zwei Drittel der grauen Emissionen eines Hauses. Gelingt es, diese bei einem Umbauprojekt zu erhalten, ist viel gewonnen – zumal die grauen Emissionen auf einen Schlag und ganz am Anfang anfallen, nicht über Jahrzehnte. Angesichts drohender Kipppunkte lohnt es sich darum, ein Gebäude mit minimalem Ressourcenaufwand für eine weitere Nutzungsphase zu ertüchtigen und erst danach zu ersetzen.

Bild: WRS / KD Busch
Mythos weißes Blatt
Die Vorstellung, der Neubau sei interessanter als der Umbau, beruht auf der verklärten Vorstellung des großen Wurfs auf dem weißen Blatt. Die Realität ist profaner. Architektur ist nur selten Selbstzweck oder Kunst. In der Regel ist sie eine Dienstleistung für Bauherrschaften und die Gesellschaft. Und darum zu Recht unfrei.
Erstens entsteht Architektur in einem rechtlichen Rahmen: Der Bund verabschiedet Leitbilder, die Länder Entwicklungsprogramme und -pläne, die Bezirke Regionalpläne und die Kommunen Flächennutzungs- und Bebauungspläne. Dazu kommen Energie- und Umweltauflagen, Regeln zum Brand- und Lärmschutz und vielerlei mehr. Baugesetze regeln detailliert Nutzungen und Abstände, wie steil ein Dach sein darf, wie breit ein Attikageschoss et cetera. Dazu kommen fast viertausend Baunormen und Nachhaltigkeitslabels als endlose Checklisten. Die Regulationsdichte im Bauen ist enorm, bisweilen absurd.
Zweitens entsteht Architektur in einem Auftragsverhältnis: Professionelle Bauherren definieren vor dem Entwurf viele Parameter detailliert. Im Wohnungsbau heißt es dann: 4,5 Zimmer mit 105 bis 110 Quadratmetern, Individualzimmer 13 bis 14 Quadratmeter, Bad mit Wanne und Waschmaschine 8 Quadratmeter, Küchen offen im Wohnraum. Manchmal sind nicht nur die Zahl der Küchenelemente, sondern auch das Material der Abdeckung oder der Wandputz vor dem Entwurf gesetzt. Und auch unterwegs gilt: Wie in jedem Beruf sind die Bedürfnisse und Vorlieben der Kundschaft zwar diskutierbar, aber entscheidend.
Drittens entsteht Architektur mit den Möglichkeiten der Bauindustrie: Repräsentative Firmensitze, Museen oder Villen mit üppigen Budgets sind Ausnahmen. Im normalen Büro- oder Wohnungsbau stecken die Baukosten einen engen Rahmen ab. Da ist der Holzbau schnell zu teuer und nur die günstigste Fassade liegt drin. Die Gestaltungsfreiheit schrumpft in solchen Fällen zu aufmunternden Farbspielen oder einem hübschen Handlauf.
Viertens entsteht Architektur in einem kulturellen und sozialen Kontext: Paragrafen und Kommissionen überwachen die »befriedigende Gesamtwirkung« von Bauten in ihrer Umgebung. Ein Glaskubus in der Altstadt oder ein quietschgelbes Haus im Gründerzeitquartier? Schwierig. Dazu kommen stilistische Vorlieben und relevante Themen der Gegenwart. Was man als Architektin auch tut, immer positioniert man sich in der Szene und im Zeitgeist.
Angesichts all dieser Einschränkungen ist das Architekturschaffen wie ein hochkomplexes Tetris-Spiel. In der A-Liga des Architekturwettbewerbs staunt man, wie verschiedene Büros dieselbe Aufgabe ganz unterschiedlich lösen. In der C-Liga dagegen, in der allgemeinen Bauproduktion landauf, landab, entstehen bedrückend einheitliche Neubauquartiere.
Alles ist Umbau
Freilich bewegt sich auch der Umbau im Korsett von Recht und Auftrag, Industrie und Kontext. Ist Umbauen also dasselbe wie Neubauen? Der Wiener Architekt Hermann Czech beschäftigt sich seit den 1970ern mit dieser Frage und kommt zum umgekehrten Schluss: »Der Umbau ist ein architekturtheoretisch wichtiges Thema; vielleicht das zentrale überhaupt – weil im Grunde alles Umbau ist.«
Was Czech meint: Ob man nun auf einer leeren oder leer geräumten Parzelle ein Haus entwirft oder ein bestehendes umbaut, immer verändert man bauend einen Status quo, immer handelt man in einem Geflecht vorgegebener Bedingungen. Dazu kommt: Selbst der Entwurf eines Neubaus auf der grünen Wiese ist je länger, je mehr wie ein Umbau. Einmal getroffene Entscheidungen rückgängig zu machen, ist eine Umplanung und kann aufwendiger sein, als einen real existierenden Raum zu verändern.
So gesehen sind beim Umbau bloß eine Reihe von Entscheidungen bereits getroffen. Letztlich stellen sich sämtliche Fragen, die es auch im Neubau gibt, bloß kommt der Baubestand als weitere Ebene hinzu. Der Umbau ist, wenn überhaupt anders, dann vielschichtiger und interessanter.
Die Freiheiten des Umbaus
Die vom Bestand vorgegebenen Entscheidungen sind nicht Einschränkungen, sondern architektonische Chancen. Es ist kein Zufall, meint das Wort »occasions« auf Englisch oder Französisch sowohl Gebrauchtwaren als auch Gelegenheiten.
Da sind die räumlichen Gelegenheiten: Im weiten Stützenraster ehemaliger Industriebauten lässt sich fast alles einrichten – Loft oder Groß-WG, Co-Workingspace oder Kleintheater, Yogastudio oder Supermarkt. Dank eines überdimensionierten Kellers, den man so nie mehr bauen würde, lässt sich Gewerbe ansiedeln, das viel Lagerplatz und tiefe Mieten braucht. Ist ein Haus vermeintlich zu breit, ersparen Stauräume in der dunklen Mitte den Mieterinnen den Weg in den Keller. Selbst kleine, tiefe und schmale Räume haben Potenzial.
Damit zu den sozialen Gelegenheiten: Ausgerechnet die Siedlungen der Nachkriegszeit mit kompakten Wohnungen und moderatem Komfort bieten die Chance, günstigen Wohnraum zu erhalten. Viele Mieter sind bereit, für eine zentrale Lage Abstriche zu machen. Und Investoren tun gut daran, ihre Portfolios zu diversifizieren. Kein Wohnsegment ist so krisenfest wie das preisgünstige.
Schließlich gibt es die gestalterischen Gelegenheiten: ein ungewöhnliches Fensterformat, ein eigenwillig gefärbter Stahlträger, eine überraschende Stufe, ein unüblicher Bodenbelag, eine rätselhafte Nische in der Wand. Was es auch ist, der Umbau bietet zahllose Gelegenheiten zur Inspiration. Sie können für kleine Abwechslungen sorgen, Irritationen im besten Sinne, oder zum entwurfsbestimmenden Thema heranwachsen. Im Spiel mit den Zeitschichten können Spannung und Identität entstehen, was bei Neubauten keineswegs einfacher ist.
Verdichtung und Geld
Aus Sicht der Architektur ist der Umbau also keine minderwertige Aufgabe. Ökologisch und sozial, räumlich und gestalterisch bietet er Chancen. Trotzdem sind die vielen Abrisse kein Zufall.
Der wichtigste Treiber ist die Immobilienökonomie. Ab einer gewissen Eingriffstiefe gilt der Umbau als »neubaugleich«. Dann gelten dieselben tausend Baunormen. Neue Lifte für alters- und behindertengerechte Wohnungen einzubauen, eine schwache Struktur für drei weitere Stockwerke zu verstärken oder dünne Decken an den heutigen Brand- und Schallschutz anzupassen – all das ist enorm aufwendig. Und damit teuer. In solchen Fällen ist der Umbau kaum günstiger als der Neubau. Weniger Material heißt zwar weniger CO2, aber oft auch mehr Arbeit. Während der Neubau in großen Elementen aufgestellt werden kann, ist der Umbau handwerklicher und kleinteiliger.
In diesem Kontext lautet ein typisches Szenario so: Eine Wohnsiedlung aus der Nachkriegszeit steht zum Verkauf. Sie ist in kritischem Zustand, das Grundstück hat einige Nutzungsreserven, der Wohnungsmix und die Grundrisse sind veraltet. Eine verantwortungsvolle Investorin untersucht beide Varianten, Neubau und Umbau, bevor sie ihr Gebot abgibt. Unterm Strich wirft das investierte Geld beim Ersatzneubau mit ideal auf den Markt zugeschnittenen Wohnungen letztlich mehr Gewinn ab. Wer von einem anderen Szenario ausgeht, hat im Bieterverfahren keine Chance, denn alle rechnen mit derselben Rendite. Der Abriss ist unvermeidbar. It’s the economy, stupid!
Es geht dabei nicht um »böse Investorinnen«, sondern um systemische Mechanismen in einem heiß umkämpften Markt. Das gilt notabene auch für die Nachfrageseite. Die Verdichtung ist politisch unbestritten, und ohnehin drängen immer mehr Gutverdienende mit entsprechenden Ansprüchen an Wohnungsgrößen, Ausstattung und Komfort in die Zentren. Die sanfte Sanierung ist zwar am ökologischsten pro Kopf, das Nachfrageproblem löst sie nicht. Anders gesagt: Unser aller Zahlungsbereitschaft und Ansprüche bestimmen die Kalkulationen am Markt. Der Abriss sind wir.
Soll es weniger Abrisse geben, sind darum vor allem andere Rahmenbedingungen gefragt. CO2-Abgaben für kostenwahre Materialpreise, reduzierte Mehrwertsteuern auf Umbauarbeiten, Flächenbonus für Bestandserhalt und -malus für den Abriss junger Bauten, gesetzliche Grenzwerte für graue Emissionen mit ambitioniertem Absenkpfad, höhere Entsorgungsgebühren, kluge Wohnschutzgesetze et cetera. Anreize und Plattformen zum Wohnungswechsel könnten den Nachfragedruck lindern. Auf der Angebotsseite fällt es nicht gewinnorientierten Immobilienplayern wie Genossenschaften, Stiftungen und kommunalen Wohnbauträgern leichter, andere Prioritäten zu setzen.
»Wicked problems« brauchen schmutzige Lösungen
Abriss oder Umbau? Die eingangs gestellte Frage ist letztlich ein wicked problem mit vielen Stakeholdern und widersprüchlichen Interessen. Massenhafte Ersatzneubauprojekte sind ökologisch und sozial problematisch. Ein Abrissmoratorium dagegen ist keine Lösung für den Wohnungsmangel, zumindest in einer freien Gesellschaft mit starken Eigentumsrechten, hohen Ansprüchen und Wünschen. Also in der Realität.
In dieser Realität ist Bauen ein politischer Akt in einem politischen Umfeld und braucht darum eine politische Antwort – den Kompromiss. Die Zukunft liegt weder einzig im Tabula-rasa-Ersatzneubau noch in der sanften Minimalsanierung, sondern in unreinen, »schmutzigen« Zwischenlösungen.
Im Architekturprojekt heißt das: Manche Gebäude oder Teile bleiben stehen. Andere verschwinden. Bei wieder anderen lässt sich darauf und daran bauen. Manchmal bleibt dabei nur das Tragwerk erhalten, manchmal auch die Fassade, manchmal selbst Küchen und Heizkörper, manchmal der Dachstuhl, manchmal nicht.
Als Architektin heißt das: Umbau und Neubau zugleich. Also die denkbar interessanteste Aufgabe.
Für die Gesellschaft heißt das: ein herrliches Durch- und Miteinander von Altem und Neuem, hohen und tiefen Häusern, kleinen und großen Wohnungen, günstigen und teuren. Je kleinteiliger diese Mischung, desto spannender das Stadtbild und desto vielfältiger die Nachbarschaft. Und das wiederum stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Platz für Zukunft
Zwei große IBA’27-Projekte werden von Genossenschaften getragen. Die Baugenossenschaft Münster eG mit dem Projekt »Zukunft Münster 2050« und die Baugenossenschaften Neues Heim und Zuffenhausen mit dem Projekt »Quartier am Rotweg« wollen gemeinsam mit der IBA ihre Bestände so ausrichten, dass sie auch in Zukunft allen ihren Mitgliedern preiswerten Wohnraum anbieten können. Die homogenen und baulich bescheidenen Genossenschaftsbestände in Stuttgart-Rot und Münster aus den 30er und 50er Jahren lassen sich jedoch nicht allein durch Umbau und Sanierung in zukunftsfähige Quartiere verwandeln. Die Wohnungen sind nicht barrierefrei, nur bedingt für kleine Haushalte geeignet und mit vertretbarem Aufwand nicht energetisch zu sanieren. Es fehlt ebenfalls an Raumtypologien, die lebenslanges Wohnen tatsächlich ermöglichen: für Pflege-WGs, gemeinschaftliches oder inklusives Wohnen, Einrichtungen für die Nachbarschaft. Wenn sich gemeinwohlorientierte Bauträger wie die Baugenossenschaften Neues Heim, Zuffenhausen und Münster für den Neubau entscheiden, gleichzeitig die Mieten in den verbleibenden Beständen niedrig halten, mit einer langfristigen und behutsamen Strategie ihr Portfolio diversifizieren und Angebote für die Nachbarschaft schaffen, ist eine breite soziale Durchmischung gewährleistet.
Qualität der Größe
Großstrukturen gehören zu den prägenden Bauwerken der Stadt. Ob Krankenhaus, Universitätscampus oder Wohnblock – Gebäude dieser Größenordnung binden viel graue Energie. Schon aus ökologischen Gründen sollten sie möglichst lange genutzt werden. Mit dem Krankenhausareal Sindelfingen und der Flandernhöhe Esslingen hat die IBA’27 zwei solcher Großstrukturen in ihrem Portfolio. Im IBA’27-Projekt »Konversion Krankenhausareal Sindelfingen« sucht die IBA’27 gemeinsam mit der Sindelfinger Stadtverwaltung nach Wegen, wie aus dem Krankenhaus ein Stadtquartier werden kann. Das Krankenhaus selbst zieht an einen neuen Standort. Zurück bleibt ein dicht bebauter Gebäudekomplex auf rund acht Hektar am Waldrand. Bürger:innen und Gemeinderat haben sich dafür entschieden, die Gebäude aus den 1960er Jahren zu erhalten und zu einem durchmischten Quartier mit Schwerpunkt Wohnen umzubauen.
Ausgang ungewiss
Beim Züblinparkhaus endet die Nutzung als Parkhaus. In der Stuttgarter Innenstadt, an der Nahtstelle zwischen Bohnen- und Leonhardsviertel, stellt sich die Frage: Abriss oder Umbau? Für das IBA’27-Projekt »Neue Mitte Leonhardsvorstadt« ist die Antwort auf diese Frage noch offen. In verschiedenen Gutachten wurde untersucht, was die Bausubstanz des Parkhauses noch leisten kann und welche Möglichkeiten für eine Umnutzung bestehen. Mit Blick auf die vielen Parkhäuser in Städten könnte das Projekt beispielhaft zeigen, welche Potenziale für die Quartiere in solchen Bauten schlummern, wenn dort statt Parken eine Mischung aus Wohnen, Arbeiten und Gemeinschaft möglich wird.
Zum Text
Dieses Essay entstand im Rahmen der siebenteiligen Serie »Die Schweiz auf Abriss« im Online-Magazin Republik. Zur Publikation an dieser Stelle wurde er lediglich geringfügig an die Verhältnisse in Deutschland angepasst.
Zum Autor
Palle Petersen ist Architekt, Aktivist bei Countdown 2030 und Redakteur bei der Schweizer Fachzeitschrift Hochparterre. Von Mitte 2022 bis Anfang 2024 arbeitete er als Lead Sustainability beim Architekturbüro Herzog & de Meuron in Basel.