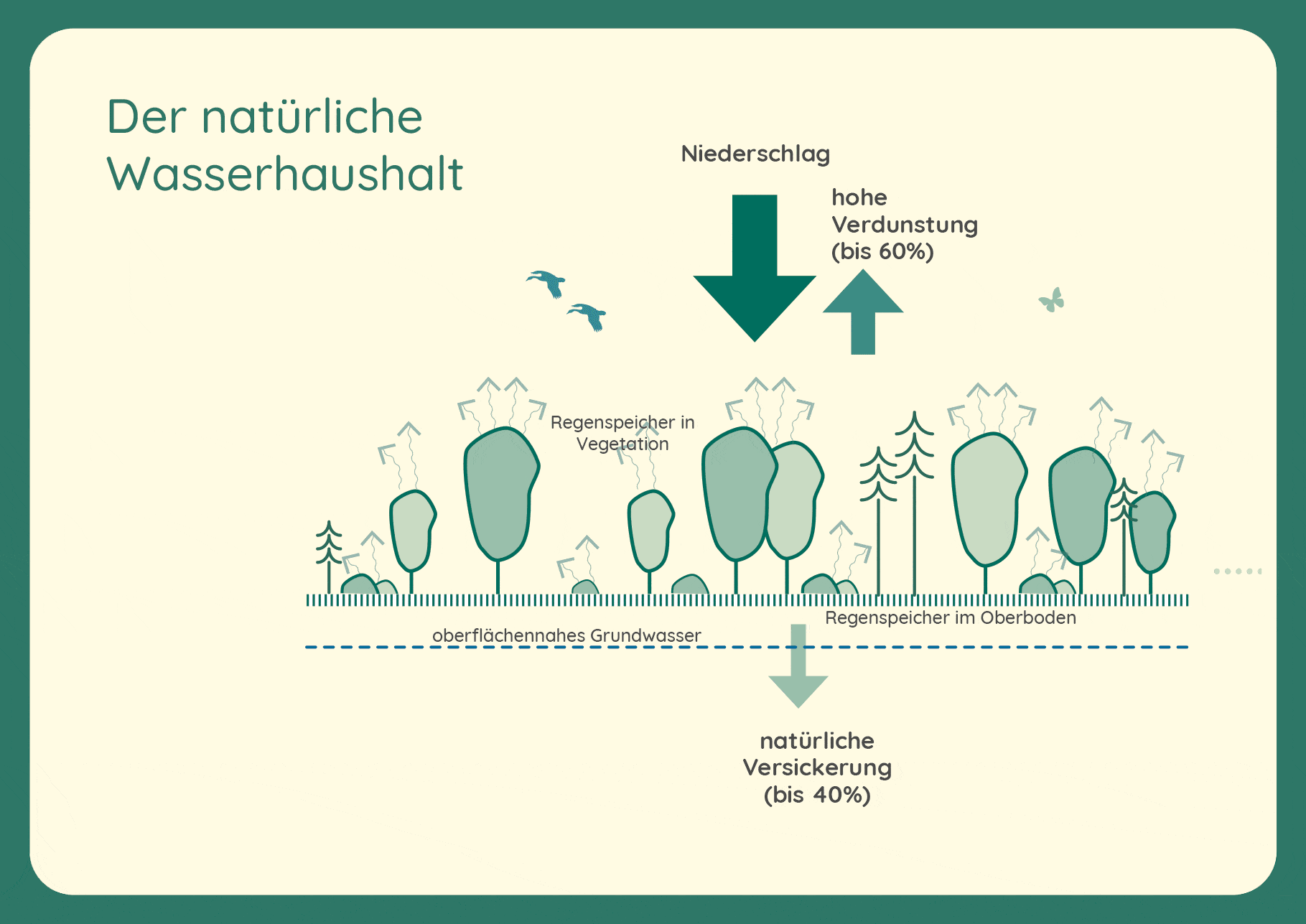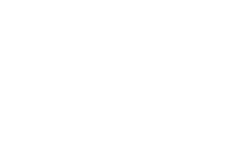Potenzialstudie Fellbach: Chancen für nachhaltige Wassernutzung und Synergien zwischen Gewerbe und Landwirtschaft
Das Forschungsprojekt »Pro.La-Fellbach« untersucht das Potenzial zur nachhaltigen Wassernutzung und Synergien zwischen Gewerbegebieten und angrenzender Landwirtschaft am Beispiel des Fellbacher IBA’27-Projektgebiets »Agriculture meets Manufacturing«. Ziel ist es, innovative Strategien zur Wasserspeicherung und -nutzung zu entwickeln, die sowohl ökologische als auch wirtschaftliche Vorteile bringen und zur Klimaanpassung beitragen.
1. Analyse des Regenwasserhaushalts im Gewerbegebiet
Das untersuchte Gewerbegebiet weist eine hohe Versiegelung auf – 67 Prozent der Fläche sind durch Gebäude, Straßen und Parkplätze bedeckt. Dies hat erhebliche Auswirkungen auf den Wasserhaushalt:
- Hoher Oberflächenabfluss: Ein Großteil des Regenwassers kann nicht versickern und wird direkt in die Kanalisation geleitet.
- Geringe Verdunstung und Grundwasserneubildung: Im Vergleich zu natürlichen Landschaften ist die Fähigkeit des Gebiets, Wasser zurückzuhalten und wieder in den Wasserkreislauf einzubringen, stark reduziert.
- Mögliche Maßnahmen: Durch eine Kombination aus Begrünungsmaßnahmen (z. B. Dach- und Fassadenbegrünung) sowie einer teilweisen Entsiegelung von Flächen könnte der Regenwasserabfluss um bis zu 32 Prozent reduziert werden. Dadurch könnte das Gebiet widerstandsfähiger gegenüber Starkregen und Hitzeperioden werden.
2. Entwicklung des interaktiven Tools »Urban Water Potentials«
Um Gewerbetreibende und Entscheidungsträger für die Auswirkungen der Wasserbewirtschaftung zu sensibilisieren, wurde das digitale Tool »Urban Water Potentials« entwickelt. Es ermöglicht Nutzern:
- den Versiegelungsgrad einzelner Grundstücke und deren Einfluss auf den Regenwasserhaushalt zu analysieren,
- Informationen über Wasserbedarf, Niederschlagsmengen und Abwasserkosten abzurufen,
- verschiedene Begrünungs- und Entsiegelungsszenarien zu simulieren und deren potenzielle Auswirkungen auf den Wasserhaushalt und die Kosten zu berechnen.
Das Tool soll als Planungsinstrument dienen und Unternehmen sowie Stadtverwaltungen bei nachhaltigen Entscheidungen unterstützen.
3. Wasserbedarf der Landwirtschaft und Nutzungsmöglichkeiten von Gewerbeabwasser
Das angrenzende landwirtschaftliche Gebiet, insbesondere der Anbau von Rucola, hat einen hohen Wasserbedarf, insbesondere in trockenen Jahren. Simulationen zeigen:
- In heißen und trockenen Perioden ist die Wasserverfügbarkeit aus natürlichen Niederschlägen nicht ausreichend.
- Ein möglicher Lösungsansatz wäre die Speicherung von Regenwasser aus dem Gewerbegebiet für landwirtschaftliche Zwecke.
- Allerdings zeigt die Analyse, dass Angebot und Nachfrage zeitlich nicht synchron sind: Regen fällt meist dann, wenn der Bewässerungsbedarf gering ist, während in Trockenperioden Wasser fehlt.
- Um diese »Regenwasserlücke« zu überbrücken, müssten Speichervolumen von bis zu 36.000 m³ bereitgestellt werden – eine erhebliche infrastrukturelle Herausforderung.
- Zusätzlich wurde untersucht, ob behandeltes Abwasser aus Gewerbebetrieben für die Bewässerung genutzt werden kann. Dies könnte helfen, Wassermangel in trockenen Zeiten zu kompensieren, würde jedoch eine weitergehende Wasseraufbereitung erfordern.
4. Empfehlungen zur nachhaltigen Wasserbewirtschaftung
Basierend auf den Forschungsergebnissen wurden folgende Maßnahmen empfohlen:
- Schaffung von Regenwasserspeichern: Große Sammelbecken oder Zisternen könnten überschüssiges Regenwasser aus dem Gewerbegebiet auffangen und für die Landwirtschaft nutzbar machen.
- Nutzung von Grauwasser aus Gewerbebetrieben: Aufbereitetes Abwasser könnte als zusätzliche Bewässerungsquelle dienen, wenn es den nötigen Qualitätsstandards entspricht.
- Errichtung separater Regenwassertrennkanäle: Diese könnten helfen, Regenwasser gezielt zu speichern und für verschiedene Zwecke verfügbar zu machen, anstatt es ungenutzt in die Kanalisation zu leiten.
- Förderung von Begrünung und Entsiegelung: Maßnahmen wie Dachbegrünungen, durchlässige Bodenbeläge und Retentionsflächen könnten helfen, das Mikroklima zu verbessern und die Wasseraufnahmefähigkeit des Gebiets zu erhöhen.
5. Übertragbarkeit auf andere Gewerbegebiete
Die Erkenntnisse aus Pro.La-Fellbach lassen sich auf viele andere Gewerbegebiete in Deutschland übertragen. Dabei sind jedoch lokale Gegebenheiten zu berücksichtigen, wie:
- Topografie und Bodenbeschaffenheit,
- bestehende Infrastruktur und rechtliche Rahmenbedingungen,
- individuelle Wasserbedarfe in Industrie und Landwirtschaft.
Insgesamt zeigt das Projekt, dass durch gezielte Anpassungen sowohl ökologische als auch wirtschaftliche Vorteile erzielt werden können.
Fazit
Das Forschungsprojekt »Pro.La-Fellbach« liefert wichtige Erkenntnisse zur nachhaltigen Wassernutzung in Gewerbegebieten und deren potenzielle Synergien mit der Landwirtschaft. Die entwickelten Strategien und das digitale Planungstool »Urban Water Potentials« bieten praxisnahe Lösungsansätze für die Herausforderungen des Klimawandels und der Wasserbewirtschaftung.
Das Projekt wurde von der Hochschule für Technik Stuttgart (HFT) in Zusammenarbeit mit der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden (OTH) sowie der Stadt Fellbach und der IBA’27 durchgeführt. Es wurde fachlich und finanziell durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) gefördert.
Zum kompletten Forschungsbericht
Projektteam Fellbach