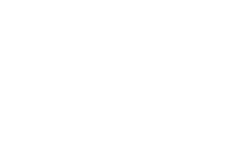Essay
Die Stadt der Zukunft ist gebaut
Text: Andreas Hofer
Der Beitrag erschien erstmalig in der ARCH+ Ausgabe 248 zur IBA’27.
In der mittelalterlichen Stadt setzte das absolutistische Recht der Herrschaft dem privaten Eigentum Schranken. Sie entstand als weltliches Abbild eines göttlichen Plans. Die Französische Revolution löste diese Verbindung auf. Der Code civil von 1804 verankerte das ungeteilte Eigentum an Grund und Boden als Privatbesitz[1]. In der Folge regelte die Planung im Wesentlichen die Erschließung und Infrastruktur mit Straßen- und Fluchtlinienplänen.
An den Rändern der Moderne
Die industrielle Stadt entstand ohne Plan. Die städtebaulichen Visionen im 20. Jahrhundert blieben Fragmente oder utopische Entwürfe, wie Le Corbusiers größenwahnsinnige Darstellungen eines neuen Paris im Plan Voisin von 1925, der eine Innenstadt ohne räumlichen Zusammenhang mit ihrer Umgebung zeigte. Dort sollten bald darauf die Siedlungen des Massenwohnungsbaus als ideale, aber autistische Setzungen entstehen. Der eigenwillige Tony Garnier, der nach fast 20 Jahren Vorarbeit 1918 seine Cité industrielle als Idealstadt präsentierte, blieb eine bemerkenswerte Ausnahme[2]. Am ehesten entstanden geplante Städte des Industriezeitalters an Orten des Rohstoffabbaus: an Minenstandorten in Sibirien (z. B. Norilsk) und auf Sardinien (Carbonia) oder an gewaltigen Staudämmen am Dnjepr. Diese taugen jedoch allein schon aus ideologischen Gründen kaum zu Vorbildern in demokratischen Gesellschaften.
Die modernistischen Großprojekte und die Verkehrsinfrastruktur für die autogerechte Stadt waren fordistische, den Zusammenhang auflösende technische Antworten für eine wachstumsgläubige Nachkriegsgesellschaft. Mit der Kritik an ihnen wuchs auch die Kritik am Geist und den Methoden ihrer Umsetzung: Der Begriff der Planung geriet in ein schiefes Licht. Wohl noch wichtiger als die Kritik an den Methoden war das Versagen der Planungsinstrumente bei der Steuerung der Siedlungsdynamik ab den 1970er-Jahren. Die weltweite Urbanisierung, die dazu führte, dass heute über die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten lebt, war im Wesentlichen ein Wachsen an den Rändern, verbunden mit einer Abnahme der baulichen und sozialen Dichte im urbanen Gefüge.
An diesen Rändern entscheidet sich die Zukunft der Stadt. Gelingt es, aus unwirtlichen Gewerbegebieten, monofunktionalen Wohnsiedlungen und Einfamilienhausteppichen funktionierende Nachbarschaften mit einer lokalen Ökonomie für eine postfossile Moderne zu schaffen? Es geht um die Fläche, um Städtenetzwerke, um Metropolitanräume und den ganzheitlichen Blick auf die Stadtregion, die Agglomeration, die Zwischenstadt, jene ungeliebten, ungeplanten Orte der Stadtbaukunst.

Jenseits von Stadt und Land
Das ETH-Studio Basel dehnte 2005 mit der Publikation Die Schweiz – Ein städtebauliches Portrait[3] diese neue Sicht auf die ganze Schweiz aus. Sie wurde als Stadt mit Quartieren beschrieben, in denen hochproduktive Zentren in einem Zusammenhang mit ländlichen Erholungsdestinationen – Ressorts – und verlassenen, ökologisch wertvollen, peripheren Räumen stehen, den alpinen Brachen. Es war eine Provokation, die den urbanistischen Blick weitete, aber kaum institutionelle oder politische Folgen hatte.
Gleichwohl setzt die IBA’27, wenn sie ein Bild der Region Stuttgart zeichnet, methodisch und inhaltlich hier an. Es gibt hier weder Stadt noch Land, es gibt nur Agglomerationen mit unterschiedlichen Qualitäten und vor allem Potenzialen. Diese Orte erweisen sich derzeit als unplanbar, weil die Instrumente in föderalen Strukturen zerfasern, und weil die simple Abstufung vom Großen ins Kleine für diese weitgehend bebauten Strukturen nicht angemessen ist. Guter Städtebau ist gleichzeitig Gesims, Haus und sozialer Raum und nicht nur ein hierarchisches Konzept, das sich vom Abstrakten ins Detail verfeinert.
Die Industrialisierung formte die Lebenswelten dieser Region. Im rohstoffarmen Württemberg nutzte sie opportun die Wasserkraft, siedelte auf trockengelegten, der Natur abgerungenen Flächen, schuf ihre Orte in den Zwischenräumen, welche die vergangene Landnahme ihr überließ. Dazwischen wuchsen nach dem Zweiten Weltkrieg Kleingewerbe und Einfamilienhäuser. Die Planung hat die Entwicklungen eher nachvollzogen als gestaltet. Das Resultat ist in seiner geografischen Logik klar und schön. Das Einkaufszentrum am Verkehrsknoten, die raumgreifenden Produktionsanlagen von Weltmarktführern als Fugen zwischen Dorfzentren mit bröckelnder Identität und den Einfamilienhausgebieten, die vielen Menschen Heimat sind, erzählen eine gemeinsame Geschichte.

Die IBA’27 hat keinen Plan, der diese Strukturen ersetzt, sondern sie verfolgt eine Strategie der Inwertsetzung. Anlässlich der IBA in Berlin 1987 wurde erkannt, dass Kreuzberg gebaut und besiedelt war und verteidigt wurde – deshalb wurde neben der »IBA Neu« eine »IBA Alt« erfunden, die dem modernistischen Einzelobjekt die Frage nach dem Bestand gegenüberstellte. Dadurch erst wurde sie produktiv. Auch die IBA’27 sucht einen solchen territorialen Kompromiss auf der regionalen Ebene. Relevante Themen sind dabei urbane Dörfer, produktive Quartiere mit Fabriken und Wohnungen, eine Landwirtschaft, die als Teil dieses städtischen Gefüges Klimaadaption erleichtert und sich in die Stoff- und Energieflüsse einklinkt.
Die Region Stuttgart hat die historischen Gene und eine Gegenwart, die sie zu einem Vorbild in diesem Transformationsprozess machen kann. Ihre bewegte Topografie verlangte von den Menschen besondere Anstrengungen, damit sie hier überleben konnten. Terrassierte Steilhänge für den Weinbau, Obstkulturen auf Weiden, die Zersplitterung des Landbesitzes und die sich daraus ergebende ökonomische Notwendigkeit, neben der Landwirtschaft auch ein Handwerk zu erlernen: All dies schuf eine kleinteilige Kulturlandschaft, ein reiches industrielles Ökosystem, dezentrale Strukturen, die sich zwar in den Produktionsweisen und den Produkten veränderten, aber bis heute weitgehend intakt sind.
Diese Landschaft ist voller Brüche, geschunden von der ersten Industrialisierung, den Bomben des Zweiten Weltkriegs, von Flucht und Wiederbeheimatung, erprobt in gesellschaftlichen, multikulturellen Prozessen. Sie hat die Flächen für ihre Neuerfindung und sie hat die Mittel, auf diesen Grundlagen die Stadt der Zukunft zu bauen. Die Stadtregion Stuttgart ist nicht einzigartig, denn die Zwischenstadt entstand an vielen Orten, aber gerade deshalb hat sie das Potential zum glaubwürdigen Beispiel für eine Neuerfindung im Bestand. Der Gedanke der einheitlichen Rekonstruktion kann hier gar nicht aufkommen, weil die Splitter der Geschichte übermächtig sind.

Ko-Kreation von Raum und Gemeinschaft
Exemplarisch für diese räumlich-ideologische Fragmentierung steht die Weissenhofsiedlung. Sie ist eines der vielen Manifeste des bewegten letzten Jahrhunderts, Überbleibsel einer Utopie, die schon während des Baus in Kritik geriet und später in ein heterogenes Umfeld einwuchs. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Siedlung zur Hälfte zerstört und danach mittelmäßig ergänzt.

Sie ist mit all ihren Widersprüchen ein Denkmal der Moderne. Allerdings ist sie ein Denkmal, das zu viel von seiner ursprünglichen Kraft verloren hat und die Doppelrolle als Wohnsiedlung und Museum nur leidlich zu spielen vermag. Es braucht deshalb eine Strategie der respektvollen Weiterentwicklung, eine dritte Schicht, die in die Zukunft führt. Dies könnte als Motto für die ganze Region stehen.
Der Fordismus hat unser Leben zerteilt: Wir akzeptierten unbewohnte Innenstädte als kulturelle und kommerzielle Zentren. Nun spielen uns die derzeitigen Veränderungen des Einzelhandels diese Räume zurück. Das gilt auch für monofunktionale Gewerbe- und Wohngebiete. An all diesen Orten ist heute mehr Stadt, mehr Gemeinschaft, mehr Experiment und mehr Aneignung möglich.
Dieser Wandel relativiert auch architektonische Streitereien des 20. Jahrhunderts. Die Moderne inszenierte sich als alternativlose Zukunft und diffamierte organische und ökologische Alternativen. Auch dieser Kampf fand in Stuttgart zwischen der modernen Weissenhof- und der traditionalistischen Kochenhofsiedlung statt und schrieb sich in den Stadtraum ein – über eine technizistische, von Behnisch bis Sobek vertretene Moderne und eine von Bonatz und Schmitthenner begründete, über Stirling und Lederer Ragnarsdóttir Oei weiterentwickelte hybride Alternative. Dabei entlarven sich beide Richtungen als pure Rhetorik. Zwischen Mies van der Rohe und Scharoun liegen Welten und Le Corbusier schaffte zwischen Weissenhof und Ronchamp einen Kosmos, den nur »Augen, die nicht sehen«[4] als Ende der Stile und der Geschichte zusammenbringen.

Nachdem die Postmoderne mit 50 Jahren genauso lang gedauert hat wie die Moderne zwischen 1920 und 1970, wäre es an der Zeit, das Scheingefecht zu beenden und sich den Herausforderungen einer Zukunft zu stellen, die keinen Platz für heroische Neuschöpfungen lässt. Die Umbaukultur muss das reiche Material, das uns 150 Jahre Industriegesellschaft hinterlassen hat, in eine sanfte, ressourcenschonende und weltgerechte Zukunft überführen.
Dafür müssen wir aber das Herrische und Normative radikal aus dem Schöpfungsprozess von Stadtplanung und Architektur streichen und es durch die Ko-Kreation von Raum und Gemeinschaft ersetzen. Es geht um eine prozesshafte Kultur des Weiterbauens anstelle von baurechtlichen Regeln, die allein auf den Neubau ausgerichtet sind. Die Abschaffung der Top-Down-Planung öffnet den Freiraum für neue Gestaltung. Dieser Schritt führt zu einer längst überfälligen, echten Demokratisierung der Baukultur, ohne die wir die Zukunft nicht meistern werden. Wer soll die Stadt gestalten, wem soll die Stadt gehören, wenn nicht den Menschen, die sie beleben? Spekulation und internationale Kapitalströme dürfen die Vielfalt der Stadt nicht weiter bedrohen, indem sie Haushalte mit beschränkten wirtschaftlichen Möglichkeiten aus den Zentren verdrängen. Neben dem veralteten Planungsrecht gehört deshalb die Neuverhandlung der Bodenfrage auf die Agenda. Vorerst wohl als neues Selbstbewusstsein der Kommunen im Umgang mit ihren Beständen, Baulandressourcen und als Förderung von gemeinwohlorientierten und langfristig denkenden Unternehmen.
Eine IBA als Ausnahmezustand auf Zeit muss Bauten zeigen. Sie muss aber auch die Frage nach den Produktionsbedingungen von Architektur stellen. In dieser prekären Zwischenzone kann Zukunft als nicht-utopischer Ort entstehen.
[1] Hildegard Schröteler‐von Brandt: »Geschichte der Stadtplanung«, in: ARL – Akademie für Raumforschung und Landesplanung (Hg.): Handwörterbuch der Stadt‐ und Raumentwicklung, Hannover 2018, S. 805–821, hier S. 806
[2] Vgl. Tony Garnier: Une cité industrielle – Étude pour la construction des villes, Paris 1918
[3] Roger Diener, Jacques Herzog, Marcel Meili, Pierre de Meuron, Christian Schmid und ETH Studio Basel – Institut Stadt der Gegenwart: Die Schweiz – Ein städtebauliches Portrait, Berlin/Boston 2005
[4] Le Corbusier: »Des yeux qui ne voient pas…«, in: L’Esprit Nouveau 8 (1921), S. 845 f.