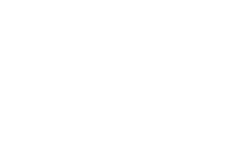Beitrag aus dem IBA’27-Kuratorium
Auf dem Weg in eine andere Innenstadt
von Tim Rieniets
Im Herbst 2018 veröffentlichte die Internationale Bauausstellung 2027 StadtRegion Stuttgart (IBA’27) fünf »Themen und Räume«, die als Richtschnur für die Projektarbeit der kommenden Jahre dienen sollen. Eines dieser Themenfelder lautet »Die Zukunft der Zentren« und widmete sich den Herausforderungen der Innenstädte in der Region Stuttgart.
Damals hatte noch niemand ahnen können, dass ein Virus mit der Bezeichnung SARS-CoV-2 eine der größten Gesundheitskrisen der Geschichte auslösen würde. Diese Krise hat Menschenleben gekostet, Krankenhäuser überlastet und das Gesundheitswesen auf die Probe gestellt. Sie hat auch alle anderen Lebensbereiche durchdrungen: Wirtschaft, Kultur und Sozialleben. Auch in den Städten war Corona allerorten zu spüren: Auf den Straßen, in den Schulen, oder auf der Arbeit – und ganz besonders augenfällig in den Stadtzentren. Wo sich früher an Samstagnachmittagen Autos stauten und Menschen drängten, herrschte während der Lockdowns auf einmal bedrückende Leere. Keine Kunden in den Geschäften, keine Gäste in den Restaurants, leere Straßen, verwaiste Plätze.
Kaum schien es, dass die Corona-Krise beherrschbar wird, sahen sich die Stadtzentren neuen Herausforderungen ausgesetzt: Zum Beispiel durch die durch Russlands hybriden Angriffskrieg verursachte Energiekrise, die bereits einige Händler dazu veranlasst hat, ihre Öffnungszeiten zu verkürzen. Oder die steigenden Lebenshaltungskosten, gepaart mit einer in der jüngeren Geschichte ungekannt hohen Inflation. Und dann noch der Arbeitskräftemangel, der Gastronomie und Einzelhandel gleichermaßen belastet. Das alles befeuerte auch die lebhafte Debatte über die Zukunft der Innenstädte – und die IBA’27 befindet sich mit ihrem Thema »Die Zukunft der Zentren« mittendrin.
Online-Handel: Fluch und Segen

Wirtschaft und Gesellschaft haben schwer unter Corona gelitten. Aber man stelle sich vor, die Pandemie hätte uns vor 20 oder 30 Jahren heimgesucht. Was hätte das für Folgen gehabt, wenn man damals die Schließung der Geschäfte zum Schutz der Bevölkerung angeordnet hätte? Vielleicht hätten die großen Versandhäuser wie Quelle und Otto Nachtschichten eingelegt, um Konsumwünsche auf dem Postweg zu erfüllen. Vielleicht hätte die Post in Windeseile neues Personal einstellen müssen, um die plötzliche Flut an Paketen befördern zu können. Vielleicht wären zusätzliche Speditionen mit dem Transport beauftragt worden, oder vielleicht hätte man sogar die Bundeswehr ausrücken lassen, um die Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten und die schlimmsten Folgen für die Wirtschaft abzuwenden.
Hätte uns das Virus damals heimgesucht, wäre eine Notlage von viel größerem Ausmaß entstanden als heute. Aber in der Zwischenzeit ist der Online-Handel auf die Bildfläche getreten (oder besser: auf den Bildschirm) und hat Vertriebswege aufgebaut, die auch dann ziemlich reibungslos funktionierten, als der stationäre Einzelhandel heruntergefahren wurde. Niemand musste unzumutbare Einschränkungen seines Konsumverhaltens hinnehmen (mal abgesehen von den anfänglichen Lieferengpässen bei Klopapier und Nudeln).
Der Online-Handel ist der große Gewinner der Pandemie, weil nun auch solche Personengruppen auf ihn zurückgreifen mussten (und es auch weiterhin tun werden), die ihn bisher gemieden haben. Der große Verlierer der Pandemie ist der stationäre Einzelhandel. Tausende Geschäfte und gastronomische Betriebe haben die coronabedingten Schließungen nicht überlebt. Einige von ihnen sind zurückgekommen, aber die Zuwächse, die der Online-Handel während der Pandemie verzeichnen konnte, wird für den stationären Einzelhandel nicht ohne Folgen bleiben. Selbst wenn derzeit vordergründig vieles wieder so aussieht wie vor der Pandemie: es wird trotzdem nicht dasselbe sein. Denn im Unterschied zu früher hat nun jeder begriffen, dass wir die Innenstädte eigentlich nicht mehr brauchen – zumindest nicht zum Einkaufen. Wir kommen auch ganz gut ohne sie zurecht.
Darin liegt die eigentliche Tragödie: dass die Innenstädte ihren Status als unentbehrliche Zentren des Handels verloren haben. Wir hatten uns in der Vergangenheit schon daran gewöhnt, dass die Konkurrenz aus dem Internet einige Branchen aus den Stadtzentren verdrängt hat. Buchhandlungen, Plattenläden oder Spielwarengeschäfte haben dort inzwischen Seltenheitswert. Aber dass wir heute nicht nur über das Schicksal einzelner Branchen sprechen, sondern über die Zukunft ganzer Innenstädte, das ist neu.
Konkurrenz im eigenen Haus
Schuld daran, dass sich bestimmte Angebote aus den Innenstädten zurückziehen, ist allerdings nicht nur der Online-Handel. Der stationäre Einzelhandel trägt eine Mitschuld an seinem Schicksal, durch den seit vielen Jahren erbarmungslos tobenden Konkurrenzkampf um Umsätze und Gewinne. Das lässt sich an der Entwicklung der Verkaufsflächen ablesen: 1970 betrug die Verkaufsfläche in der Bundesrepublik 0,56 Quadratmeter pro Kopf, heute sind es fast 1,5 Quadratmeter.[1] Die Konsumausgaben, die von den Kundinnen und Kunden auf dieser Verkaufsfläche getätigt werden, sind aber nicht in gleicher Weise gestiegen. Darum ist der Umsatz, den ein Einzelhändler heute pro Quadratmeter Verkaufsfläche generieren kann, wesentlich geringer als früher.[2] Und mancher Laden, der nicht in der Lage war, diese Einbußen an anderer Stelle zu kompensieren, ist daran zugrunde gegangen.
Betroffen sind vor allem die kleinen Geschäfte. Hatte ein Lebensmittelgeschäft im Jahr 1965 durchschnittlich 400 Quadratmeter Verkaufsfläche, auf denen 3.200 Produkte angeboten wurden, waren es 2015 11.600 Artikel auf 1.150 Quadratmetern.[3] Vergleichbare Trends waren auch in anderen Sparten zu beobachten. Werkzeuge kaufen wir heute bei Obi, Bücher beim Platzhirsch Thalia und elektrische Geräte bei Mediamarkt. Geiz ist geil!
Die Folge dieses Konkurrenzkampfes ist, dass die kleinen, oft noch eigentümergeführten Geschäfte, die den Innenstädten lange Zeit ein Gesicht und ein Gedächtnis gaben, vom Aussterben bedroht sind. Sie werden verdrängt von den großen Ketten und den voluminösen Fachmärkten, die zwar ein viel umfangreicheres Sortiment anbieten, aber keinen Bezug zu ihrem Standort haben.

Als Drittes tragen auch die Kommunen eine Mitschuld an der Situation des Einzelhandels. Sie haben es zugelassen, dass immer neue Flächen für den großflächigen Einzelhandel ausgewiesen wurden, und das meistens außerhalb der Stadtzentren. So konnten Fachmärkte und Einkaufscenter auf der grünen Wiese entstehen, die nicht nur wegen ihrer banalen und maßstabssprengenden Architektur ein Ärgernis sind, sondern auch, weil sie den traditionellen zentralen Handelsstandorten die Kundschaft streitig machten. Man hätte wissen müssen, dass die Entwicklung nicht nur Gewinner haben kann. Denn Einzelhandelsflächen lassen sich beliebig vermehren, das Geld der Menschen, das dort ausgegeben werden soll, aber nicht.
Die Innenstädte haben sich also schon lange vor der Pandemie verändert – und sie werden es auch nach ihr tun. Die Corona-Krise hat diese Tendenzen lediglich verstärkt. Sie war wie eine unfreiwillige Zeitreise in die Zukunft. In dieser Zukunft wird es die Innenstadt, wie wir sie bisher kannten, nicht mehr geben.
Wer macht die Zukunft?
Es hat immer etwas Beängstigendes, wenn plötzlich etwas zu verschwinden droht, dessen Existenz so sicher war, wie das Amen in der Kirche. So mag es nun auch manch einem mit der Vorstellung ergehen, dass die Innenstädte irgendwann nicht mehr die Zentren des Einzelhandels sein werden. Aber diese Vorstellung hat auch etwas Befreiendes. Sie befreit uns vom Paradigma des Konsums und zwingt uns darüber nachzudenken, wie es auch ohne Konsum gehen könnte. Ideen dafür gibt es bereits genug – die beispielhaft auch in IBA-Projekten wie »Neue Mitte Leonhardsvorstadt« auch ausprobiert werden sollen: Man könnte mehr Gastronomie und Freizeitangebote schaffen und mehr Wohnraum. Man könnte Handwerk und Gewerbe zurück in die Städte holen. Man könnte gemeinnützige Angebote schaffen und kulturelle Nutzungen ansiedeln. Und natürlich soll alles viel grüner und nachhaltiger werden. Aber was ist richtig? Und was ist überhaupt möglich?
Die letzte Frage lässt sich recht einfach beantworten: Unter den derzeitigen Marktbedingungen, die in den Innenstädten herrschen, sind keine bahnbrechenden Veränderungen zu erwarten. Die Mietpreise, die dort aufgerufen werden, haben inzwischen so exorbitante Höhen erreicht, dass praktisch alle Nutzungen jenseits des Einzelhandels ausgeschlossen sind. In den besonders angesagten Lagen deutscher Großstädte sind Mietpreise von über 300 Euro pro Quadratmeter Erdgeschossfläche keine Seltenheit. Und auch in kleineren Städten und weniger attraktiven Lagen liegen sie weit über dem, was man zum Beispiel mit einer Wohnnutzung erwirtschaften könnte – ganz zu schweigen von einer kulturellen oder sozialen Nutzung, die bekanntlich auf geringe Mieten angewiesen sind. Erschwinglicher wird es in den Obergeschossen, aber viele Eigentümer versuchen erst gar nicht, diese Geschosse zu vermieten, weil das angesichts der hohen Erträge aus den Erdgeschossen nicht der Mühe wert ist.

Sollen die Innenstädte in Zukunft anders aussehen und lebendig bleiben, dann müssten die Immobilieneigentümerinnen ihre Renditeerwartungen radikal senken. Aber das werden sie nur tun, wenn sie nicht anders können. Doch von dieser Situation sind wir noch weit entfernt. Selbst in jenen Lagen, in denen sich die Leerstände häufen, lassen die Eigentümer ihre Immobilien lieber leer stehen, als ihr Vermietungskonzept zu überdenken – in der Hoffnung, irgendwann wieder eine zahlungskräftige Mieterin zu finden.
Man könnte darauf spekulieren, dass mancherorts die abnehmende Nachfrage nach Handelsimmobilien von ganz alleine dazu führen wird, dass die Eigentümer ihre Renditeerwartungen anpassen müssen. Dass die Preise aber derart tief sinken werden, dass erschwinglicher Wohnraum oder kulturelle Nutzungen entstehen können, wo H&M oder Douglas noch vor Kurzem hohe Mieten gezahlt haben, ist nicht zu erwarten. Und selbst wenn es so weit käme, wäre das noch keine Garantie dafür, dass aus dieser Situation eine bessere Zukunft für die Innenstädte hervorgehen würde.
Ein Blick in die betroffenen Innenstädte bestätigt den Befund. Weder der Einzelhandel noch der Immobilienmarkt haben dort dem Abwärtstrend der vergangenen Jahre etwas Nennenswertes entgegensetzen können. Keine neuen Nutzungskonzepte, keine neue Architektur, keine neuen Finanzierungs- oder Betreibermodelle. Alle machen weiter wie bisher, auch dann, wenn immer klarer wird, dass das bisherige Modell nicht mehr funktionieren wird. Offenbar wird das Risiko des gemeinsamen Niedergangs eher in Kauf genommen, als das Risiko der individuellen Veränderung. Oder wie es der amerikanische Ökonomen Maynard Keynes einmal sagte: Für den Ruf ist es besser, konventionell zu scheitern, als unkonventionell Erfolg zu haben.
Ohne ein beherztes Eingreifen von Politik und Planung ist also keine Veränderung zum Bessern zu erwarten. Doch den verantwortlichen Akteurinnen, allen voran den Kommunen, fehlt es an geeigneten Mitteln. Sie haben weder das Geld noch die planungsrechtlichen Instrumente, um wirksam in das Geschehen eingreifen zu können. Sie müssen sich mit der Rolle des Vermittelns und Moderierens zufriedengeben. Soll sich das ändern, dann brauchen die Kommunen entsprechende politische und planungsrechtliche Instrumente. Und die müssen erst noch geschaffen werden.
Die IBA und die Innenstadt
Bis es so weit kommt (wenn überhaupt), wird noch viel Zeit vergehen – wertvolle Zeit, die für die Transformation der Innenstädte genutzt werden müsste. In dieser Zeit könnte eine vierte Akteurin ins Spiel kommen. Nicht der Einzelhandel, nicht der Immobilienmarkt und auch nicht die Kommunen, sondern eine unabhängige Akteurin wie die IBA’27. Auch sie verfügt nicht über die finanziellen oder rechtlichen Mittel, um in das Geschehen eingreifen zu können, aber sie verfügt über Unabhängigkeit, Glaubwürdigkeit und fachliche Expertise. Und sie verfügt über ein hohes kommunikatives Potenzial. Sie kann Menschen zusammenbringen und für die Zukunft ihrer Städte begeistern. Und noch etwas kann die IBA: Sie vermag eine Atmosphäre zu schaffen, in der Neues entstehen kann. Eine Atmosphäre, in der man nicht um seinen guten Ruf fürchten muss, wenn man etwas Unkonventionelles wagt.
Für die Innenstädte könnte sich die Corona-Krise vielleicht sogar als Glücksfall erweisen, denn sie hat uns zu einem Zeitpunkt auf die Fehlentwicklungen in unseren Innenstädten aufmerksam gemacht, als wir noch genügend Zeit zum Umsteuern hatten. Der zweite Glücksfall ist die IBA’27. Sie kommt mit ihrem Themenfeld »Zukunft der Zentren« genau zum richtigen Zeitpunkt und kann Anstöße für Neues geben, zu denen andere Akteure noch nicht bereit sind.
[1] Rahlf, Thomas: Zeitreihendatensatz für Deutschland, 1834-2012, in histat Historische Statistik. https://histat.gesis.org/histat, Januar 2022
[2] Statista: Umsatz je Quadratmeter Verkaufsfläche im Einzelhandel in Deutschland in den Jahren 1970 bis 2018. https://de.statista.com, Januar 2022
[3] Handelsdaten: Verkaufsfläche und Anzahl Artikel von Lebensmittelgeschäften. https://www.handelsdaten.de, September 2016
Über den Autor

Tim Rieniets ist Professor für Stadt- und Raumentwicklung in einer diversifizierten Gesellschaft an der Leibniz Universität Hannover. Seine Forschungs- und Vermittlungstätigkeiten konzentrieren sich u. a. auf die Themen schrumpfende Städte, soziale Segregation und Integration im Städtebau sowie Umbau- und Revitalisierungsstrategien für Wohnbau, Gewerbeimmobilien und Kirchen.
Tim Rieniets ist Mitglied im Kuratorium der IBA’27.